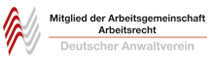Kohnen & Krag Rechtsanwälte in Hamburg verfügen über langjährige praktische Erfahrung im Arbeitsrecht, Verkehrsrecht, Erbrecht & portugiesischem Recht!
Etwas mehr als jeder zweite Arbeitnehmer bekommt – meist mit dem Novembergehalt – von seinem Arbeitgeber Weihnachtsgeld. Immer wieder kommt es zu Fragen rund um diese Sonderzahlung.
Vor diesem Hintergrund wollen wir im Folgenden einige wichtige Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichtes darstellen und die daraus zu ziehenden rechtlichen Folgerungen anhand von uns häufig gestellten Fragen skizzieren. Wir hoffen, Ihnen hiermit einen guten Überblick rund um das Thema Weihnachtsgeld zu geben.
Dient eine Sonderzuwendung nicht der Vergütung geleisteter Arbeit und knüpft sie nur an den Bestand des Arbeitsverhältnisses an, stellt es keine unangemessene Benachteiligung gemäß § 307 BGB dar, wenn der ungekündigte Bestand des Arbeitsverhältnisses zum Auszahlungstag als Anspruchsvoraussetzung bestimmt wird.
In diesem Urteil hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass ein Anspruch auf das Weihnachtsgeld grundsätzlich vom ungekündigten Bestehen des Arbeitsverhältnisses zum Auszahlungszeitpunkt abhängig gemacht werden kann. Entscheidend ist allerdings der Zweck der Zahlung und damit die Rechtsnatur des Weihnachtsgeldes. Knüpft die Zahlung ausschließlich an den Bestand des Arbeitsverhältnisses an (Belohnungscharakter), dann kann die Auszahlung vom ungekündigten Bestand des Arbeitsverhältnisses abhängig gemacht werden. Anders ist dies aber, wenn die Zahlung des Weihnachtsgeldes (zumindest auch) Entgeltcharakter hat.
Eine Sonderzahlung die auch Gegenleistung für im gesamten Kalenderjahr erbrachte Arbeit darstellt, kann in Allgemeinen Geschäftsbedingungen regelmäßig nicht vom Bestand des Arbeitsverhältnisses am 31. Dezember des betreffenden Jahres abhängig gemacht werden.
Hier hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass Weihnachtgelder mit Mischcharakter, die jedenfalls auch Vergütung für bereits erbrachte Arbeitsleistung sind, in Formulararbeitsverträgen (dies ist mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemeint) nicht vom ungekündigten Bestand des Arbeitsverhältnisses zu einem Stichtag abhängig gemacht werden können. Dies würde dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung widersprechen. Die Arbeit wurde ja bereits geleistet, dementsprechend ist sie auch zu bezahlen.
Die zulässige Bindungsdauer, die durch die Pflicht zur Rückzahlung einer Gratifikation für den Fall des Ausscheidens aus dem Betrieb erreicht werden kann, richtet sich nach der Höhe und dem Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit der Leistung. Dies gilt auch dann, wenn eine als einheitlich bezeichnete Leistung in zwei Teilbeträgen zu unterschiedlichen Zeitpunkten fällig wird.
Hier hatte das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass Arbeitnehmer bei einem Weihnachtsgeld von mehr als 100 € bis zur Höhe eines Bruttomonatsgehaltes bis zum 31.03. des Folgejahres gebunden werden können. Bei höheren Beträgen sind auch längere Bindungsdauern möglich (s.u.).
1. Eine tarifliche Regelung, die die Kürzung des Weihnachtsgeldes um DM 1000 einheitlich für Voll- und Teilzeitbeschäftigte vorsieht, führt zu einer Benachteiligung der Teilzeitbeschäftigen, weil der auf diese Weise errechnete Betrag unter der Summe liegt, die dem Anteil der Teilzeitarbeit im Verhältnis zur Vollzeitarbeit entspricht.
Nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes führt dieser Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot zur Unwirksamkeit der tariflichen Berechnungsweise und damit zur Wiederherstellung der tariflichen Grundregelung, wonach Teilzeitbeschäftigte einen Anspruch auf ein Weihnachtsgeld haben, dass sich nach dem Verhältnis zur tariflichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollzeitbeschäftigten bemisst.
Bei einer Verknüpfung von Freiwilligkeitsvorbehalt und Widerrufsvorbehalt in einem Arbeitsvertrag wird für den Arbeitnehmer nicht hinreichend deutlich, dass trotz mehrfacher, ohne weitere Vorbehalte erfolgender Sonderzahlungen, ein Rechtsbindungswille für die Zukunft ausgeschlossen bleiben soll.
Hier hatte sich der Arbeitgeber quasi doppelt abgesichert und sowohl einen Freiwilligkeitsvorbehalt als auch einen Widerrufsvorbehalt vereinbart. Er hatte eine Klausel aufgenommen, die wie folgt lautete:
„Soweit der Arbeitgeber gesetzlich oder durch Tarifvertrag nicht vorgeschriebene Leistungen, wie Prämien, Zulagen, Urlaubsgeld, Gratifikationen, Weihnachtsgratifikationen gewährt, erfolgen sie freiwillig und ohne weitere Verpflichtungen. Sie sind daher ohne Wahrung einer besonderen Frist widerrufbar.“
Da sich jedoch Freiwilligkeitsvorbehalt und Widerrufsvorbehalt gegenseitig ausschließen, kann nicht beides gleichzeitig vereinbart werden. Bei einem Freiwilligkeitsvorbehalt teilt der Arbeitgeber mit, dass er für die Zukunft keine Verpflichtung eingehen will. Dies wäre grundsätzlich möglich (siehe unten).
Der Widerrufsvorbehalt hingegen beinhaltet die Regelung, dass grundsätzlich ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Zahlung von Weihnachtsgeld besteht, diese Pflicht des Arbeitgebers zur Zahlung des Weihnachtsgeldes jedoch in der Zukunft widerruflich ist. Auch dies wäre grundsätzlich möglich (siehe unten).
Aus der Verwendung beider Vorbehalte jedoch ist für den Arbeitnehmer nicht ersichtlich, ob denn eigentlich ein Weihnachtsgeldanspruch besteht oder nicht. Die Klausel ist daher nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts intransparent und damit insgesamt unwirksam.
Hier hatte das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass ein Anspruch auf das Weihnachtsgeld besteht, wenn der Arbeitgeber eine bestimmte Arbeitnehmergruppe von der Zahlung des Weihnachtsgeldes ohne sachlichen Grund ausnimmt (allgemeiner Gleichbehandlungsgrundsatz).
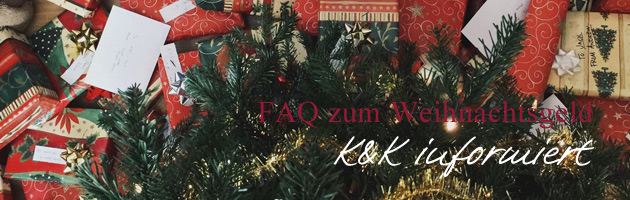
FAQ zum Weihnachtsgeld
Aus den vorgenannten Entscheidungen lassen sich Rechtsgrundsätze herleiten und die meisten typischen Fragen rund um das Weihnachtsgeld beantworten.
Das meist im November ausgezahlte Weihnachtsgeld ist eine Sonderzahlung, die zusätzlich zum Gehalt gezahlt wird. Es handelt sich um eine sogenannte Gratifikation, welche aufgrund des anstehenden Weihnachtsfestes gezahlt wird. Vergleichbar ist das Weihnachtsgeld mit dem Urlaubsgeld, welches meist im Mai aufgrund der anstehenden Sommerferien vom Arbeitgeber gezahlt wird. Bei beiden Sonderzahlungen handelt es sich um Arbeitsentgelt, sodass hierauf jeweils Sozialversicherungsbeiträge und Steuern anfallen.
Einen Anspruch auf Weihnachtsgeld gibt es grundsätzlich nur bei entsprechender Rechtsgrundlage. Dies sind häufig Vereinbarungen im Arbeitsvertrag, beispielsweise wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der jeweilige Arbeitnehmer zwölf Gehälter, sowie zusätzlich ein halbes Monatsgehalt als Urlaubsgeld im Mai und ein halbes Monatsgehalt Weihnachtsgeld im November ausgezahlt bekommt oder wenn ausdrücklich ein 13. Monatsgehalt gezahlt wird. Ebenso finden sich häufig Regelungen in Tarifverträgen, oder auch in Betriebsvereinbarungen.
Eine weitere – beim Weihnachtsgeld häufig anzutreffende – Rechtsgrundlage ist die sogenannte betriebliche Übung. Eine solche liegt vor, wenn der Arbeitgeber über mindestens drei Jahre Weihnachtsgeld in gleicher Höhe, oder aber nach der gleichen Berechnungsmethode gezahlt hat, ohne diese Zahlung unter den Vorbehalt der Freiwilligkeit zu stellen.
Ein Anspruch kann sich auch aus dem sogenannten arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz ergeben. Wenn alle Arbeitnehmer, oder alle Arbeitnehmer einer bestimmten Arbeitnehmergruppe Weihnachtsgeld erhalten, so kann der Arbeitgeber diesen einzelnen Arbeitnehmern oder einzelnen vergleichbaren Arbeitnehmergruppen das Weihnachtsgeld nicht ohne sachlichen Grund vorenthalten.
Dies ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung ist jedoch, dass der Arbeitnehmer nicht bereits einen Anspruch auf Zahlung des Weihnachtsgeldes aus dem Arbeitsvertrag, aus einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung hat. In einem solchem Fall besteht ja grundsätzlich gar keine Rechtpflicht des Arbeitgebers Weihnachtsgeld zu zahlen.
Tut er dies dennoch, so geschieht dies grundsätzlich freiwillig, also ohne Verpflichtung hierzu. In einem solchen Fall kommt dann allerdings bei mehrfacher Zahlung des Weihnachtsgeldes die sogenannte betriebliche Übung in Betracht, wonach der Arbeitnehmer wiederum einen Anspruch auf Weihnachtsgeld erwerben kann. Eine solche betriebliche Übung setzt wie dargelegt voraus, dass der Arbeitgeber über drei Jahre hinweg das Weihnachtsgeld ohne Vorbehalt der freiwilligen Zahlung gezahlt hat.
Vor diesem Hintergrund zahlen Arbeitgeber das Weihnachtsgeld häufig unter dem Vorbehalt der Freiwilligkeit. Dies ist auch vollkommen in Ordnung, da ja eigentlich gar keine Pflicht zu Zahlung besteht und der Arbeitgeber also mehr gibt, als er nach den vertraglichen Vereinbarungen eigentlich müsste. Ist jedoch einmal eine betriebliche Übung entstanden, so ist der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, auch im nächsten Jahr ebenfalls Weihnachtsgeld zu zahlen.
Auch dies ist bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen möglich. Im Gegensatz zum vorgenannten Freiwilligkeitsvorbehalt setzt ein Widerrufsvorbehalt jedoch voraus, dass ein Anspruch des Arbeitnehmers schon besteht und der Arbeitgeber eigentlich nicht mehr freiwillig zahlt, sich jedoch gegebenenfalls zukünftig durch einen einseitigen Widerruf dieser Pflicht wieder entledigen kann.
Hier ist stets zu prüfen, ob der Widerrufsvorbehalt, insbesondere wenn er in einem Formulararbeitsvertrag formuliert wurde, was häufig der Fall ist, den Voraussetzungen der Rechtsprechung genügt. Zunächst einmal darf er nicht an überraschender Stelle im Vertrag formuliert sein. Zudem muss er transparent formuliert sein und die Gründe für einen etwaigen Widerruf bereits benennen. Genügt der Widerrufsvorbehalt nicht den strengen Regeln der Rechtsprechung, ist er unwirksam und der Arbeitgeber bleibt trotz Widerruf zur Zahlung des Weihnachtsgeldes verpflichtet.
Dies hängt (vgl. die ersten beiden Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichtes in diesem Artikel) davon ab, zu welchem Zweck das Weihnachtsgeld gezahlt wird.
Wenn im Arbeitsvertrag beispielsweise ein Bruttojahresgehalt vereinbart wurde, welches in 13 Monatsgehältern gezahlt wird, so besteht ein reiner Entgeltcharakter. In diesem Fall sowie bei Mischformen, bei denen das Weihnachtsgeld sowohl für Betriebstreue, als auch für Vergütung für die verbrachten Dienste gezahlt wird, ist ein Anspruch des Arbeitnehmers auch bei unterjährigem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis zumindest anteilig gegeben. Denn der Arbeitnehmer hat sich das Weihnachtsgeld ja anteilig schon verdient. Scheidet er beispielsweise zum Ende Juni aus, so ist klar, dass das dreizehnte Monatsgehalt zur Hälfte bereits „erarbeitet“ wurde.
Es ist grundsätzlich zwar zulässig, das Weihnachtsgeld nur an bestimmte Gruppen von Arbeitnehmer zu zahlen, bzw. bestimmte Gruppen von der Zahlung des Weihnachtsgeldes auszunehmen. Allerdings muss stets ein sachlicher Grund für diese Ungleichbehandlung vorliegen. Ansonsten haben auch die ausgenommenen Arbeitnehmer Anspruch auf die Zahlung von Weihnachtsgeld. Bei teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern ist dies im Benachteiligungsverbot gesetzlich verankert.
Unter bestimmten Voraussetzungen können Weihnachtsgelder auch nachträglich vom Arbeitgeber wieder zurückverlangt werden. Die Rechtsprechung hat hier jedoch feste Regeln aufgestellt. Insbesondere ist eine Rückforderung bei Weihnachtsgeldern bis zu 100 € überhaupt nicht möglich.
Bei Beträgen zwischen 100 € und einem Bruttomonatslohn ist eine Bindung des Arbeitnehmers nur bis zum 31.03. des Folgejahres bei Zahlung des Weihnachtsgeldes zum Jahresende möglich, bei Weihnachtsgeldern über einem Bruttomonatslohn kommt eine Bindung bis zum 30.06. des Folgejahres bei Zahlung des Weihnachtsgeldes zum Jahresende in Betracht.
Dies kommt darauf an. Teilweise wird ein Arbeitsverhältnis für einen bestimmten Zeitraum nicht fortgesetzt, wie beispielsweise in Elternzeit, oder bei längerer Krankheit. Ob in diesem Fall ein Anspruch auf Weihnachtsgeld besteht, entscheidet die Rechtsprechung wiederum danach, welchen Charakter die Zahlung des Weihnachtsgeldes hat.
Hat das Weihnachtsgeld reinen Entgeltcharakter, kann der Arbeitgeber die Zahlung des Arbeitgebers grundsätzlich bei längerer Arbeitsunfähigkeit kürzen. Denn bei Weihnachtsgeldzahlungen mit reinem Entgeltcharakter kann für die Sonderzahlung nichts anderes gelten, als für die reguläre monatliche Gehaltszahlung. Hat der Arbeitnehmer also teilweise nicht gearbeitet, so kann der Arbeitgeber das Weihnachtsgeld anteilig kürzen, auch wenn dies nicht gesondert vertraglich vereinbart wurde.
Erfolgt die Weihnachtsgeldzahlung jedoch alleine als Belohnung für die Betriebstreue, so ist eine Kürzung nicht zulässig, denn das Arbeitsverhältnis besteht ja als solches noch fort und der Anknüpfungspunkt für die Zahlung ist ja alleine der Bestand des Arbeitsverhältnisses.
Bei Sonderzahlungen mit Mischcharakter kann eine Kürzung grundsätzlich für das ruhende Arbeitsverhältnis vereinbart werden, allerdings besteht ohne ein solches arbeitsvertraglich oder tarifvertraglich vereinbartes Kürzungsrecht keine automatische Befugnis des Arbeitgebers zur Leistungsminderung (anders als bei Zahlungen mit reinem Entgeltcharakter).
Wir hoffen, Ihnen einen guten Überblick gegeben zu haben. Sollten Sie zum Thema Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Lars Kohnen
Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg
Gruner + Jahr, eines der größten Medienunternehmen in Deutschland, plant, 700 Mitarbeiter am Standort Hamburg zu entlassen. Das teilte die Muttergesellschaft RTL Group mit. Die Entlassungen sollen mehrere Abteilungen des Unternehmens betreffen, darunter auch Redaktions- und Verwaltungsmitarbeiter.
Die RTL Group hat erklärt, dass dieser Schritt notwendig sei, um Kosten zu senken und effizienter zu werden. Leider sind viele der Betroffenen schon seit Jahren bei Gruner + Jahr beschäftigt und stehen nun vor einer ungewissen Zukunft. Diese Nachricht ist für viele in der Branche ein Schock, aber es scheint, dass die RTL Group entschlossen ist, diesen Schritt trotz der möglichen negativen Auswirkungen auf die Mitarbeiter und die lokale Wirtschaft zu vollziehen. Der Großteil des Stellenabbaus soll Stellen aus dem Verwaltungsbereich in Hamburg betreffen, so dass hier mit einer entsprechenden Kündigungswelle zu rechnen ist.
Wenn Sie mit einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch Ihren Arbeitgeber konfrontiert sind, sollten Sie sich schnell an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht wenden. Ein im Arbeitsrecht erfahrener Anwalt kann Ihnen dabei helfen, Ihre Rechte als Arbeitnehmer zu verstehen und sicherzustellen, dass das Kündigungsverfahren für Sie möglichst vorteilhaft abläuft.
Denn ein Spezialist kennt die einschlägigen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit Entlassungen und weiß, wo die Fehlerquellen bei Kündigungen liegen. Er ist in der Lage, Ihren Vertrag zu prüfen, den Sozialplan zu bewerten und Ihnen die rechtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern und Sie zu beraten, wie Sie mit der Kündigung umgehen sollen.
Er kann Sie auch über Aufhebungsverträge und Abfindungsvereinbarungen beraten, die der Arbeitgeber möglicherweise anbietet und insbesondere auch deren sozialversicherungsrechtliche Nachteile wie beispielswies eine etwaige Sperrzeit beim Bezug von Arbeitslosengeld beurteilen.
Darüber hinaus kann er Sie bei Bedarf vor Gericht vertreten und mit Ihnen zusammenarbeiten, um eine möglichst hohe Abfindung auszuhandeln. Mit anwaltlicher Hilfe können Sie sich vor ungerechter Behandlung schützen und sicherstellen, dass Ihre Rechte in dieser schwierigen Zeit gewahrt bleiben.
Rufen Sie uns für ein unverbindliches telefonisches Erstgespräch unter 040 20 90 52 74 an.
Zwar ist kein Fall im Arbeitsrecht genau wie der andere und häufig sind Problemstellungen, die in einem Fall so zu lösen sind, in einem ähnlich gelagerten Fall anders zu betrachten. Allerdings werde ich als Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg immer wieder mit bestimmten Fragen bzw. Vorstellungen unserer Mandanten konfrontiert, die häufig nicht den tatsächlichen arbeitsrechtlichen Gegebenheiten entsprechen.
Da jedoch nur der, der seine Rechte kennt, oder aber zumindest ein Problembewusstsein für bestimmte Ansprüche hat, diese auch geltend machen kann, möchte ich Ihnen hier zu häufigen, Fehlvorstellungen im Arbeitsrecht meiner Mandanten kurz Auskunft geben, eventuell geht es Ihnen ja ähnlich.
Häufig kommen Arbeitnehmer zu uns in die Kanzlei und zeigen mir eine Kündigung, die ihnen der Arbeitgeber während der Krankheit ausgesprochen hat. Sie sind dann teils der Ansicht, diese sei ja bereits unwirksam, da sie während der Krankheit erfolgte. Leider muss ich dies dann verneinen. Die Kündigung ist zumindest nicht aufgrund des Umstandes unwirksam, dass sie während einer Arbeitsunfähigkeit ausgesprochen wurde oder zugegangen ist. Denn grundsätzlich kann eine Kündigung zu jeder Zeit und an jedem Ort wirksam erklärt werden.
Häufig ist die Kündigung jedoch aus anderen Gründen unwirksam, oder aber zumindest angreifbar, sodass Sie in jedem Fall die Dreiwochenfrist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage beachten und rechtzeitig einen im Arbeitsrecht tätigen Rechtsanwalt aufsuchen sollten.
Hier gilt das Gleiche: Eine Kündigung kann grundsätzlich zu jeder Zeit und an jedem Ort wirksam erklärt werden. Dies gilt auch an gesetzlichen Feiertagen und während des Urlaubs. Allenfalls kommt bei einem für einen Arbeitnehmer besonders beeinträchtigenden Zugangszeitpunkt eine Unwirksamkeit der Kündigung in Betracht. Dies dürfte jedoch eher theoretischer Natur sein.
Dem Arbeitgeber kann auch in der Regel nicht vorgehalten werden, dass er ja von dem mehrwöchigen Urlaub des Arbeitnehmers wusste und die Kündigung daher extra in diesem Zeitraum ausgesprochen hat, damit die Kündigungsschutzklagen-Frist von drei Wochen verpasst wird. Denn in der Regel ist ein Arbeitnehmer gehalten, dafür Sorge zu tragen, dass die Post, die ihm zugesendet wird, auch zur Kenntnis genommen wird.
Unsere Rechtsanwaltskanzlei rät ihren Mandanten daher stets, bei einem längeren Urlaub als zwei Wochen, den Briefkasten regelmäßig durch Verwandte oder Bekannte kontrollieren zu lassen. Insbesondere wenn es schon Anzeichen dafür gibt, dass eine Kündigung im Raume steht. Sollten Sie erst nach einer mehrwöchigen Urlaubsrückkehr von der im Hausbriefkasten eingeworfenen Kündigung Kenntnis erlangen und nicht Vorsorge getroffen haben, so sollten sie sofort reagieren und einen im Arbeitsrecht versierten Anwalt aufsuchen. Eventuell kann die dreiwöchige Frist nach § 4 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) dann noch eingehalten werden. Sollte diese jedoch bereits abgelaufen sein, so besteht eventuell noch die Möglichkeit auf eine nachträgliche Zulassung der Klage vor dem Arbeitsgericht (§ 5 KSchG). Hierzu bedarf es eines besonderen Antrags. Hierauf sollten Sie es jedoch nicht ankommen lassen, da dies ein Sonderfall ist.
Auch wenn dies häufig der Fall ist, so ist diese Rechtsvorstellung jedoch noch lange nicht immer korrekt.
Festzuhalten ist zunächst einmal, dass eine Abmahnung bei personen- (insbesondere krankheits-) und betriebsbedingten Kündigungen ohnehin nicht Voraussetzung ist. Nur bei verhaltensbedingten Kündigungen ist die Abmahnung von Relevanz.
In der Regel ist bei einer verhaltensbedingten Kündigung dann auch eine Abmahnung vor Ausspruch der Kündigung Voraussetzung. Wenn allerdings das Fehlverhalten so gravierend war, dass das Vertrauensverhältnis nicht wiederherstellbar ist, kann auch schon bei erstmaligem Fehlverhalten, oder aber bei mehrfachem Fehlverhalten ohne Abmahnung, eine verhaltensbedingte Kündigung gerechtfertigt sein. Dies ist jedoch sehr selten. In der Regel ist die Abmahnung vor einer verhaltensbedingten Kündigung erforderlich, denn sie erfüllt eine Warnfunktion dahingehend, dass bei gleichartigen Pflichtverletzungen gegebenenfalls eine Kündigung folgt.
Wenn zu erwarten ist, dass der Arbeitnehmer sein Verhalten ändert und kein erheblicher Vertrauensverlust vorliegt, ist die Abmahnung dementsprechend vor der Kündigung vorrangig (Ultima-Ratio-Prinzip), bzw. es ist vom Arbeitgeber darzulegen, dass eine Verhaltensänderung eben gerade nicht zu erwarten ist. Hierzu ist aber in der Regel die Abmahnung erforderlich, da ja ansonsten kaum vorhergesagt werden kann, wie sich der Arbeitnehmer verhält. Wenn er allerdings trotz Abmahnung das gleiche Verhalten weiterhin an den Tag legt, so ist ein Schluss darauf zulässig, dass dies auch in Zukunft zu erwarten ist.
Dies ist eine weit verbreitete Annahme. Allerdings gibt es auch eine solche Regel im Kündigungsschutzrecht nicht. Vielmehr muss – wie so häufig im Arbeitsrecht – jeder Fall einzeln bewertet werden. Es kann sein, dass schon eine Abmahnung reicht, es kann aber auch sein, dass mehrere Abmahnungen erforderlich sind.
Abmahnungen dienen generell dazu, den Arbeitnehmer für ein konkretes Fehlverhalten zu rügen und ihn gleichzeitig aufzufordern, sich in Zukunft vertragsgemäß zu verhalten. Zudem werden ihm im Wiederholungsfall ernsthafte, arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses angedroht. Erfüllt die Abmahnung diese formalen Voraussetzungen und erfolgt ein weiterer Verstoß, so kann grundsätzlich bereits nach der ersten Abmahnung eine verhaltensbedingte Kündigung gerechtfertigt sein. Es bedarf also nicht drei Abmahnungen.
Als Arbeitnehmer sollten Sie also ab der ersten Abmahnung auf der Hut sein. Andererseits sollten Sie nicht davon ausgehen, dass nur weil drei Abmahnungen erfolgten, die Kündigung gerechtfertigt ist. Überprüft werden kann dies stets. Auch werden bei den Abmahnungen häufig Formfehler gemacht, sodass diese gar nicht wirksam sind. Erfüllt eine Abmahnung die oben genannten Voraussetzungen aber nicht, so kann auf ihrer Grundlage später auch keine wirksame Kündigung ausgesprochen werden. Dies kann auch noch im Rahmen der Kündigungsschutzklage überprüft werden.
Eine zu häufige Abmahnung kann sogar nachteilig sein, da der Arbeitgeber damit zu erkennen gibt, dass er seine Kündigungsandrohung ja doch nicht wahrmacht.
Es kann auch sein, dass ein Arbeitgeber bereits sechs Abmahnungen ausgesprochen hat und dennoch nicht kündigen kann, wenn es sich beispielsweise um stets andere Pflichtverletzungen handelt und / oder die Abmahnungen zeitlich so weit auseinander liegen, dass sie sich zwischenzeitlich erledigt haben.
Auch diese Vorstellung ist falsch. Die Nichtangabe des Kündigungsgrundes macht die Kündigung nicht unwirksam. Der Arbeitgeber ist zwar verpflichtet, dem Arbeitnehmer den Kündigungsgrund mitzuteilen. Er muss dies jedoch nur nach Aufforderung durch den Arbeitnehmer tun. Dies soll den Arbeitnehmer in die Lage versetzen, zu prüfen, ob die Kündigung rechtmäßig ist. In der Praxis teilen Arbeitgeber die Kündigungsgründe jedoch häufig erst im Rahmen einer Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht mit.
Etwas anderes gilt jedoch bei Kündigungen von Schwangeren oder Auszubildenden. Diese sind tatsächlich nur dann wirksam, wenn im Kündigungsschreiben der Kündigungsgrund angegeben wurde.
Leider ist auch dies ein Irrtum. Arbeitgeber benötigen nur einen Kündigungsgrund, wenn das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) anwendbar ist. Dies ist nicht der Fall, wenn das Arbeitsverhältnis noch keine sechs Monate gedauert hat. Entscheidend ist insofern der Zugang der Kündigung. Die Dauer des bestehenden Arbeitsverhältnisses ergibt sich nicht aus dem Datum, an dem der Arbeitsvertrag geschlossen wurde, sondern wird gezählt ab dem tatsächlichen Beschäftigungsbeginn.
Auch in kleinen Betrieben, die nicht mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigen, ist das Kündigungsschutzgesetz grundsätzlich nicht anwendbar. Die Regelungen hierzu finden sich in § 23 KSchG. Dies ist jedenfalls für Neueinstellungen ab dem 01.01.2004 der Fall. Für Altangestellte kann es noch auf die geringere Zahl von fünf Arbeitnehmern ankommen. Dies ist jedoch immer seltener der Fall. Bei der Feststellung der Zahl der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer ebenfalls zu berücksichtigen. Arbeiten diese regelmäßig nicht mehr als 20 Stunden, zählen sie mit 0,5 und arbeiten sie nicht mehr als 30 Stunden, mit 0,75.
Auch wenn das Arbeitsverhältnis aus anderen Gründen beendet wird, kann es sein, dass der Arbeitnehmer trotz Vorliegens der vorgenannten Voraussetzungen keinen Kündigungsschutz genießt. Dies kann zum Beispiel bei Befristungen der Fall sein. Allerdings ist auch hier zu prüfen, ob die Befristung tatsächlich wirksam vereinbart wurde.
Andererseits kann es sein, dass ein Arbeitnehmer Kündigungsschutz außerhalb der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes (Allgemeiner Kündigungsschutz) genießt. Wenn nämlich der Arbeitnehmer besonderen Kündigungsschutz genießt, wie dies beispielsweise bei Schwangeren der Fall ist. Dieser besondere Kündigungsschutz besteht auch in kleinen Betrieben .
Häufig wird die Vereinbarung einer Probezeit von der Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes nicht hinreichend unterschieden. Mandanten, die eine Probezeit, beispielsweise von drei Monaten, vereinbart haben, meinen, anschließend Kündigungsschutz zu genießen. Gleiches gilt für Mandanten ganz ohne Probezeit. Hier ist jedoch die Probezeit (§ 622 BGB) von der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes (§ 23 KSchG) streng zu unterscheiden. Es ist nur zufällig der gleiche Zeitraum von sechs Monaten, die meistens eine Probezeit beträgt.
Der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz greift, ebenso wie der Kündigungsschutz für Schwerbehinderte, erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. In diesen sechs Monaten kann der Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis grundsätzlich ohne Kündigungsgrund – unter Beachtung des Verbots treu-, oder sittenwidriger Kündigungen – kündigen. Einen Kündigungsgrund braucht er erst danach. Dies gilt auch für den Fall, dass mit dem Arbeitnehmer keine Probezeit, oder eine kürzere Probezeit als sechs Monate, vereinbart wurde. Die Probezeit betrifft grundsätzlich vielmehr die Frage, ob die Kündigungsfrist während dieser Zeit verkürzt werden kann. Gleichzeitig kann allerdings auch – obwohl eine Probezeit vereinbart wurde – bereits besonderer Kündigungsschutz beispielsweise für Schwangere bestehen, sodass zwar eine kürzere Kündigungsfrist wegen der Probezeit gelten würde, der Arbeitnehmer aber dennoch (besonderen) Kündigungsschutz genießt.
Hier gilt § 623 BGB: Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Dies gilt im Übrigen sowohl für die Kündigung durch den Arbeitgeber, als auch für die Kündigung durch den Arbeitnehmer. Wie dem Gesetz zu entnehmen ist, gilt das Schriftformerfordernis auch für einen Aufhebungsvertrag. Arbeitsverhältnisse müssen also immer schriftlich beendet werden. Dies bedeutet in Papierform und versehen mit der Originalunterschrift des Kündigenden. Eine Kündigung per Fax, E-Mail, PDF, Telegramm, SMS, Whatsapp oder ähnlichem ist daher bereits aus diesem Grund unwirksam. Egal ob in einem Kleinbetrieb, oder ob der Arbeitnehmer nur zehn Tage beschäftigt war. Es ist vollkommen egal, ob das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist, oder nicht – die Schriftform muss stets eingehalten werden. Zudem kann die Schriftform nach § 623 BGB auch nicht durch individuelle Vereinbarungen, Tarifvertrag, oder Betriebsvereinbarung umgangen werden.
Zu seiner Wirksamkeit bedarf ein Arbeitsvertrag, anders als die Kündigung, oder Aufhebung des Arbeitsvertrages, keiner Form. Ein Arbeitsverhältnis kann auch per Fax, E-Mail, mündlich oder durch schlüssiges Verhalten (man fängt an zu arbeiten und erhält Geld dafür) geschlossen werden. Es kann jedoch vorkommen, dass in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen Schriftformerfordernisse bestehen, die den Abschluss eines Arbeitsvertrages betreffen.
Dieser Irrtum ist zwar nicht weit verbreitet, jedoch besonders gefährlich. Gegen eine Kündigung müssen Sie sich binnen drei Wochen mit einer Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht wehren. Nach Ablauf dieser Frist können Sie die Kündigung nicht mehr angreifen, allenfalls in Ausnahmefällen gibt es die Möglichkeit einer nachträglichen Zulassung der verspäteten Klage. Insofern bitte ich auch zu beachten, dass dies auch gilt, wenn Sie im Urlaub sind, oder krank (s.o.).
Für die Wirksamkeit der Kündigung kommt es nicht entscheidend darauf an, ob der Betriebsrat dieser zustimmt oder nicht. § 102 BetrVG schreibt lediglich vor, dass der Betriebsrat angehört werden muss. Eine Kündigung, die ohne eine solche Anhörung erfolgte, ist unwirksam. Das Gleiche ist der Fall, wenn die Anhörung des Betriebsrats zwar erfolgte, aber fehlerhaft.
Ob die Kündigung erfolgt, oder nicht, kann jedoch der Betriebsrat nicht entscheiden, sondern allein der Arbeitgeber. Wenn der Betriebsrat der Kündigung jedoch nicht zustimmt, sondern widerspricht, verbessert sich dennoch die Rechtsposition des Arbeitnehmers. Denn in einem solchen Fall kann ein entsprechender betriebsverfassungsrechtlicher Weiterbeschäftigungs-anspruch durch den Arbeitnehmer geltend gemacht werden.
Dem Arbeitnehmer eröffnet sich die Chance, bis zum rechtskräftigen Abschluss eines eventuellen Kündigungsschutzprozesses im Betrieb zu verbleiben. Selbst wenn sich die Kündigung dann als wirksam erweisen sollte, hat er während der Dauer des Rechtsstreits (ab dem erstinstanzlichen Urteil) weiterhin im Betrieb gearbeitet und Arbeitslohn verdient.
Dies kann sich einerseits entscheidend auf die soziale Absicherung während dieser Zeit auswirken, gegebenenfalls auch eine Zeit bis zum Renteneintritt überbrücken. Zudem wird hierdurch auch ein entsprechender Druck auf den Arbeitgeber aufgebaut werden können, was sich positiv bei Abfindungsverhandlungen auswirkt. Auch ist positiv, dass der Arbeitnehmer im Falle des Obsiegens im Kündigungsschutzprozess durchgehend im Betrieb integriert bleibt und kein Know-How verliert. Dies ist jedoch selten der Fall, da die meisten Kündigungsschutzprozesse mit Abfindungsvergleichen beendet werden.
Zwar wird – wie gerade beschrieben – in den meisten Fällen eine Abfindung nach einer Kündigung gezahlt. In der Regel gibt es einen entsprechenden Anspruch hierauf jedoch nicht. Ein solcher Anspruch kann beispielsweise bestehen, wenn zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ein Sozialplan ausgehandelt wurde. In seltenen Fällen kann das Arbeitsgericht auf Antrag auch das Arbeitsverhältnis auflösen und dem Arbeitnehmer eine Abfindung zusprechen. Diese Fälle sind jedoch eher die Ausnahme.
Die üblichen Fälle sehen so aus, dass der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis kündigt. Ein Anspruch auf Abfindung besteht nicht. Der Arbeitnehmer kann sich jedoch gegen die Kündigung mit einer Kündigungsschutzklage wehren. Im Rahmen dieses Kündigungsschutzprozesses wird dann häufig ein Vergleich dahingehend geschlossen, dass der Arbeitnehmer die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch die Kündigung akzeptiert und der Arbeitgeber sich im Gegenzug verpflichtet, eine Abfindung zu zahlen.
Grundsätzlich dient das Kündigungsschutzgesetz allerdings nur dem Schutz des Arbeitsplatzes und normiert keinen Abfindungsanspruch. Häufig geht die Interessenlage der Parteien jedoch dahin, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht mehr im Betrieb haben möchte und auch der Arbeitnehmer nicht wirklich an seinem Arbeitsplatz festhalten möchte, sodass er sich bei Zahlung einer entsprechend hohen Abfindung bereit erklärt, die Kündigung zu akzeptieren. Die Höhe der Abfindung hängt insbesondere von den Erfolgsaussichten der gegen die Kündigung gerichteten Klage, sowie vom sogenannten Annahmeverzugslohnrisiko des Arbeitgebers ab. Nähere Informationen hierzu finden Sie in meinem Text zur Abfindung.
Dies höre ich häufig und immer wieder. Es ist und bleibt jedoch falsch. Generell ist eine Abfindung nicht auf das Arbeitslosengeld anzurechnen. Allerdings ist bei einem entsprechenden Vergleich darauf zu achten, dass die Kündigungsfrist nicht verkürzt wird. In einem solchen Fall kann es gemäß §158 SGB III zu einem Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs bei Zahlung einer Abfindung kommen. Dies ist allerdings im weiteren Sinne auch kein Anrechnen, sondern nur ein Ruhen. Das Arbeitslosengeld wird dann erst ab einem späteren Zeitpunkt erfüllt. Zu beachten ist, dass während dieser Ruhenszeit kein Kranken- und kein Pflegeversicherungsschutz besteht und keine entsprechenden Beiträge abgeführt werden. Ein solcher Ruhens-Zeitraum verkürzt jedoch nicht den generellen Bezugs-Zeitraum vom Arbeitslosengeld. Sollte also der Arbeitslosengeld-Zeitraum vollständig ausgeschöpft werden, würde gleich viel Arbeitslosengeld gezahlt werden. In dem Fall allerdings, in dem vorher bereits eine neue Arbeitsstelle gefunden wird, würde es im Rahmen des Ruhens tatsächlich zu einer geringeren Zahlung von Arbeitslosengeld kommen. Vor diesem Hintergrund empfehle ich stets, im Vergleich die Kündigungsfrist nicht zu verkürzen.
Von dem zeitlich befristeten Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld ist im Übrigen die Verhängung einer Sperrzeit zu unterscheiden. Hier ist neben den vorgenannten Erläuterungen zusätzlich mit einer Verkürzung des Arbeitslosengeldanspruchs zu rechnen. Bei einer Sperrzeit, beispielsweise wegen Arbeitsaufgabe oder Abschluss eines Aufhebungsvertrages, ist es so, dass nicht nur drei Monate später gezahlt wird, sondern diese Zeit auch nicht „hinten dran gehängt wird“, es insgesamt also tatsächlich weniger Arbeitslosengeld gibt.
Bei Aufhebungsverträgen ist daher besondere Aufmerksamkeit geboten. Durch bestimmte Gestaltungswege lässt sich hier gegebenenfalls eine Sperrzeit vermeiden.
Man könnte die Liste der Rechtsirrtümer und Fragen noch beliebig weiter führen. Dies sind jedoch die häufigsten, die mir immer wieder begegnen. Insofern möchte ich jedoch noch anmerken, dass Arbeitnehmer häufig der Ansicht sind, dass bestimmte Regelungen im Arbeitsvertrag zu beachten sind. Auch dies ist jedoch nicht immer richtig, da Arbeitgeber häufig Regelungen treffen, die bei genauerer Betrachtung bzw. Überprüfung durch das Arbeitsgericht unwirksam sind.
Natürlich kann man seine Rechte aber nur wahrnehmen, wenn man um diese weiß. Sollten Sie daher nicht sicher sein, ob alles mit rechten Dingen zugeht, informieren Sie sich bitte rechtzeitig und beachten insbesondere die Dreiwochenfrist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage, sowie etwaige Ausschlussfristen im Arbeitsvertrag oder einem anwendbaren Tarifvertrag. Nach Ablauf dieser Fristen kann Ihnen in der Regel auch der beste Anwalt nicht mehr helfen.
Jeder Rechtsanwalt wird Sie im Übrigen vorab über etwaige Kosten des Beratungsgesprächs aufklären, sodass Sie entscheiden können, ob es sinnvoll ist, diese Beratung in Anspruch zu nehmen, oder nicht.
Lars Kohnen
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg
Das KAG Rottenburg-Stuttgart hat mit Urteil vom 27.09.2021 – AS 09/21 – Klarheit bei der Abgrenzung der Zuständigkeiten von Mitarbeitervertretung (MAV) und Gesamtmitarbeitervertretung (GMAV) für den Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Arbeitszeitregelung geschaffen.
In dem zu entscheidenden Fall hatte die klagende MAV vom beklagten Dienstgeber die Unterlassung der Anwendung einer zwischen diesem und seiner GMAV geschlossenen Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit in ihrem Zuständigkeitsbereich geklagt und vom Gericht Recht bekommen. Das Gericht führte aus, dass die Ausübung der Mitbestimmungsrechte nach der MAVO grundsätzlich der von den Dienstnehmern unmittelbar gewählten MAV (sog. erste Mitbestimmungsebene) obliegt.
Die Zuständigkeit der GMAV setzt sowohl aufgrund ihrer Funktion als einrichtungsübergreifendes Repräsentationsorgan (sog. zweite Mitbestimmungsebene) als auch nach § 24 Abs. 6 S. 1 MAVO 2 Dinge voraus, die beide für eine Zuständigkeit der GMAV vorliegen müssen: Erstens muss die Angelegenheit mehrere oder alle Einrichtungen des Dienstgebers betreffen und zweitens muss die Angelegenheit durch die einzelne MAV vor Ort in ihrer Einrichtung nicht geregelt werden können. Im zu entscheidenden Fall fehlte es nach Ansicht des Gerichtes an der zweiten Voraussetzung. Es bestand nach Ansicht des Gerichts kein zwingendes Erfordernis für eine die Geschäftsstelle der Beklagten einbeziehende unternehmenseinheitliche bzw. einrichtungsübergreifende Regelung zur Arbeitszeit.
Aus diesem Grunde würden Arbeitszeitregelungen in der Regel in die Zuständigkeit der MAV in den jeweiligen Einrichtungen fallen. Die Entscheidung gibt insofern Auslegungshilfen für das „nicht-regeln-können“ als zweite Voraussetzung. Hier kommt es entscheidend darauf an, ob ein zwingendes Erfordernis für eine unternehmenseinheitliche oder zumindest einrichtungsübergreifende Regelung besteht. Ist dies nicht der Fall, bleibt die MAV vor Ort zuständig. Mit der Entscheidung wird daher die Zuständigkeit der örtlichen MAV für die Ausübung der Mitbestimmungsrechte gestärkt.
Weitere Informationen vom erfahrenen Rechtsanwalt für kirchliches Arbeitsrecht.
Am 14.11.2016 führte RTL Aktuell nach der Veröffentlichung des Spiegel Online Artikels zum Anspruch auf Weihnachtsgeld ein Interview mit Fachanwalt Kohnen.
Der TV-Beitrag „Schöne Bescherung: Wer bekommt Weihnachtsgeld?“ kann bis zum 26.11.2016 auf RTL.de angesehen werden.

Fachanwalt Lars Kohnen im TV-Bericht von RTL Aktuell
Vor ein paar Tagen hatte ich die Gelegenheit Janko Tietz von Spiegel Online ein paar Fragen zum Thema Weihnachtsgeld zu beantworten. Das Interview „Wann muss der Arbeitgeber Weihnachtsgeld zahlen?“ ist nun auf Spiegel.de veröffentlicht.
Herzlichen Dank an Herrn Tietz für das freundliche Gespräch und viel Spaß beim Lesen. Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion hier im Blog oder unter dem Interview nutzen.
Weitere Infos zum Weihnachtsgeld gibt es zudem im aktuellen Blogbeitrag „Alle Jahre wieder: Gibt es Ärger mit dem Weihnachtsgeld“ auf Kohnen & Krag.
Das Landesarbeitsgericht Hamm Das Landesarbeitsgericht Hamm hat in seiner Entscheidung Aufschluss darüber gegeben, ob ein Betriebsrat gemäß § 104 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) die Entfernung des Geschäftsführers einer GmbH verlangen kann.
§ 104 BetrVG besagt, dass im Falle einer wiederholten ernstlichen Störung des Betriebsfriedens durch einen Arbeitnehmer, der Betriebsrat ermächtigt ist, vom Arbeitgeber die Entlassung oder Versetzung des fraglichen Arbeitnehmers zu verlangen. Umstritten war hier insbesondere der Begriff des Arbeitnehmers und in Bezug auf diesen die Anwendung des Unionsrechts.
Der vom Gericht zu entscheidende Streit hatte die Forderung des Betriebsrates einer GmbH &Co KG an die Arbeitgeberin zum Gegenstand, den Geschäftsführer der Verwaltungs-GmbH aus dem Unternehmen zu entfernen. Der Betriebsrat stütze seine Forderung auf die ihm eingeräumten Rechte aus § 104 BetrVG. Der fragliche Geschäftsführer habe wiederholt und ernstlich den Betriebsfrieden dadurch gestört, dass er bewusst wahrheitswidrige Informationen in Personalfällen an den Betriebsrat herausgegeben habe.
Nach gescheiterten außergerichtlichen Lösungsversuchen hat der Betriebsrat die Forderung an die Arbeitgeberin ausgesprochen. Diese lehnte die Forderung mit dem Hinweis darauf ab, der Geschäftsführer sei kein Arbeitnehmer im Sinne des § 104 BetrVG, daher habe der Betriebsrat keine Befugnis, eine Entlassung zu fordern. Streitentscheidend war hierbei die Definition des betriebsstörenden Arbeitnehmers.
Nachdem das Arbeitsgericht Bochum in erster Instanz bereits entschieden hatte, der Geschäftsführer sei als Organvertreter der GmbH kein Arbeitnehmer im Sinne des § 104 BetrVG und die Norm damit nicht anwendbar, legte der Kläger Beschwerde ein und die Entscheidung lag beim LArbG Hamm.
Der Kläger brachte vor, dass auf den Schutzzweck des § 104 BetrVG abgestellt werden und der Begriff des Arbeitnehmers daher weiter gefasst werden müsse. Dies würde auch durch das Unionsrecht gestützt, welches auch Organvertreter, die vom nationalen Recht von den Arbeitnehmern ausgeschlossen werden, also solche definiere.
Das LArbG Hamm stellte zunächst fest, dass nach nationalem Recht ein Geschäftsführer einer GmbH als Organmitglied zur gesetzlichen Vertretung einer juristischen Person berufen und kein Arbeitnehmer im Sinne des BetrVG sei. Dies sei schon im § 5 II Nr. 1 BetrVG explizit so benannt. Der Gesetzestext lautet:
Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht: in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist.
Es gebe hier wegen des eindeutigen Wortlauts keinen Raum für eine weite Auslegung nach dem Schutzzweck.
Des Weiteren legte das Gericht dar, dass in diesem Falle das Unionsrecht nicht anwendbar sei. Dieses habe zwar in mehreren Entscheidungen auch Mitglieder von Organvertretern juristischer Personen als Arbeitnehmer definiert, könne aber nur dann in das nationale Recht durchgreifen, wenn die fragliche Rechtsvorschrift eine solche ist, die in Ausfüllung der erlassenen europäischen Richtlinien ergangen ist.
Dies sei bei § 104 BetrVG nicht der Fall. In Konsequenz wies das LArbG die Beschwerde zurück.
Nach geltendem deutschen Recht ist ein Geschäftsführer einer GmbH als Organmitglied zur Vertretung der GmbH berufen und gemäß § 5 II Nr. 1 BetrVG kein Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes. Daher kann seine Entlassung nicht vom Betriebsrat gefordert werden.
Quelle: Landesarbeitsgericht Hamm, Entscheidung vom 02.08.2016, 7 TaBV 11/16
In einem Beschluss vom 28. Juli 2016 hat sich das Bundesarbeitsgericht mit der Kündigung des Chefarztes eines katholischen Krankenhauses wegen Wiederverheiratung beschäftigt.
Die Ausgangslage des Rechtsstreits bildete die Kündigung eines Chefarztes eines katholischen Krankenhauses durch die Beklagte als Trägerin des Krankenhauses. Der Kläger war seit dem Jahre 2000 in dem Krankenhaus angestellt.
Der Anstellung lag die Grundordnung des kirchlichen Dienstes vom 22. September 1993 (GrO) zu Grunde. Artikel 5 dieser Verordnung regelt das Vorgehen, wenn ein Mitarbeiter den Anforderungen der katholischen Grundordnung nicht genügt. Zu einem solchen Mangel gehört unter anderem das Eingehen einer – nach Verständnis der katholischen Kirche – ungültigen Ehe. Ein solches sei ein schwerer Loyalitätsverstoß und könne gemäß Artikel 5 II GrO eine Kündigung nach sich ziehen. Unvermeidlich sei eine Kündigung gemäß Artikel 5 III GrO, wenn der schwere Loyalitätsverstoß von einer Person in einer leitenden Position begangen werde und keine schwerwiegenden Gründe des Einzelfalles eine Kündigung verhindern.
Nach katholischem Rechtsverständnis ist eine Ehe dann ungültig, wenn der Eheschließende noch durch eine frühere Ehe gebunden ist. Dies ist auch dann der Fall, wenn die frühere Ehe aufgelöst, also geschieden worden ist.
Nachdem der Kläger sich von seiner ersten Ehefrau im Jahr 2008 hat scheiden lassen, heiratete er ein zweites Mal standesamtlich. Diese zweite Heirat ist nach geltendem Recht der katholischen Kirche ungültig. Die Beklagte erlangte Kenntnis von diesem Vorgang und kündigte dem Chefarzt ordentlich mit Schreiben vom 30. März 2009. Sie stütze ihre Argumentation auf die oben genannten Artikel der GrO. Der Kläger wehrte sich gegen die Kündigung mit dem Hinweis, dass derselbe Tatbestand bei evangelischen Chefärzten ohne Folgen bliebe.
Nachdem das Arbeitsgericht, sowie das Landesarbeitsgericht der Klage stattgegeben hatten, gelangte die Sache zum BAG. Dieses bewertete die Kündigung grundsätzlich zwar als im Einklang mit der dem Selbstbestimmungsgrundsatz der Beklagten unterliegenden GrO und somit als gerechtfertigt.
Allerdings sei die differenzierte Anwendung des Ethos der katholischen Kirche insofern inkonsequent, dass auch nichtkatholische Angestellte in leitenden Positionen besetzt seien und diese dem Loyalitätsgrundsatz in anderem Maße unterliegen würden als katholische.
Des Weiteren sei das nichteheliche Zusammenleben des Klägers mit seiner neuen Partnerin bekannt und toleriert gewesen, obwohl auch dieses gegen das katholische Ethos verstoße. In Konsequenz sei eine Weiterbeschäftigung zumutbar und die Kündigung mithin sozial ungerechtfertigt.
Das Urteil des BAG wurde durch Beschluss vom 22. Oktober 2014 wegen einer Grundrechtsverletzung der Religionsfreiheit nach Art. 4 I und II GG in Verbindung mit Art. 140 GG und Art. 137 III der Weimarer Reichsverfassung vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben und an das BAG zurückverwiesen.
Nun, am 28.07.2016, hat der BAG die Sache an den EuGH weitergeleitet mit Bitte um eine Klärung der Frage, ob nach Unionsrecht, im Einzelnen nach Art. 4 II b der Richtlinie 2000/78/EG, eine Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern abhängig von ihrer Religionsangehörigkeit gerechtfertigt ist, oder nicht. Weitere Informationen vom erfahrenen Rechtsanwalt für kirchliches Arbeitsrecht.
Quelle: BAG, Beschluss vom 28. Juli 2016 – 2 AZR 746/14 (A) –, Pressemitteilung Nr. 39/16
Mit Urteil vom 24.08.2016 bejahte das Bundesarbeitsgericht rückwirkend den Anspruch einer Klägerin auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Diese war vom 15.07.2013 – bis zum 15.12.2013 als Pflegehilfskraft bei dem Beklagten, dem Betreiber eines ambulanten Pflegedienstes, angestellt.
Diesem Arbeitsverhältnis lag ein Arbeitsvertrag zugrunde, welcher eine als Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) verfasste Ausschlussfrist enthielt, nach welcher sämtliche Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, sowie Ansprüche, die mit diesem in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie ab Fälligkeit nicht innerhalb von drei Monaten zunächst gegenüber dem Anspruchsgegner schriftlich geltend gemacht und – im Falle ihrer Ablehnung oder einer Nichtäußerung des Anspruchsgegners – auch gerichtlich geltend gemacht werden. Dies ist eine sogenannten zweistufige Ausschlussfrist. Näheres entnehmen Sie bitte meinem allgemeinen Artikel zu Ausschlussfristen.
Die Klägerin war vom 19.11.2013 bis einschließlich zum 15.12.2013 arbeitsunfähig krankgeschrieben. Die ihr für diesen Zeitraum eigentlich zustehende Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall wollte der Beklagte nicht entrichten, da er an der Arbeitsunfähigkeit der Klägerin zweifelte. Diese versuchte ihren Anspruch schließlich – jedoch nach Ablauf der im Arbeitsvertrag genannten Frist – gerichtlich geltend zu machen, woraufhin der Beklagte sich darauf gestützt hatte, dass der Anspruch der Klägerin jedenfalls verfallen sei.
Das Arbeitsgericht gab der Klage statt, die Berufung des Beklagten wurde zurückgewiesen und auch die Revision vor dem Bundesarbeitsgericht blieb schließlich erfolglos.
Als Begründung führte das Bundesarbeitsgericht an, dass eine allgemeine Verfallsklausel, die also sämtliche Ansprüche, so auch den nach § 2 PflegeArbbV bestehenden Anspruch auf Mindestentgelt in der Pflege ausdrücklich ausschließt, gegen § 9 S. 3 AEntG i.V.m. § 13 AEntG verstoße und somit unwirksam sei. Nach diesen Normen ist ein Ausschluss des Mindestentgelts über AGB nicht möglich.
Einen solchen Ausschluss hatte der Beklagte hier jedoch in der allgemeinen Verfallsfrist mit angelegt, bzw. war er zumindest nicht ausdrücklich vom Verfall der Ansprüche ausgenommen. Somit bestand der Anspruch der Klägerin auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall hier weiterhin, er unterlag keiner (wirksamen) Ausschlussfrist. Die Mindestlohnansprüche konnte die Klausel gar nicht verfallen lassen (s.o.). Was weitere von der allgemeinem Ausschlussklausel erfasste Ansprüche anbelangt, also vorliegend die auf Entgeltfortzahlung, die die Zahlung des Mindestentgelts nicht betreffen, greife nämlich § 307 I BGB. Diese Norm enthält das sogenannte Transparenzgebot: Verwendet z.B. ein Arbeitgeber eine AGB, die den anderen Vertragsteil unangemessen benachteiligt, so ist diese unwirksam. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Klausel nicht klar und verständlich ist.
Hier war nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts die vom Arbeitgeber verwendete formularvertragliche Ausschlussklausel für die Arbeitnehmerin unangemessen benachteiligend und nach § 307 BGB insgesamt unwirksam: Die allgemeine Ausschlussfrist für sämtliche das Arbeitsverhältnis betreffende Ansprüche war unwirksam, da sie ihrem Wortlaut nach halt auch Ansprüche auf Mindesentgelt mit umfasste.
Mit dieser Entscheidung stärkte das Bundesarbeitsgericht die Position der Arbeitnehmer deutlich, indem es klarstellte, dass diese nicht auf den Mindestlohn verzichten könnten und in diesem Zusammenhang formularvertraglich fixierte allgemeine Ausschlussfristen für ungültig erklärte. Dies betreffe nach dem Urteil des BAG dann auch nicht nur die Ansprüche auf Mindestlohn, sondern sämtliche Ansprüche, da die Klausel insgesamt unwirksam sei. Das Urteil erging zwar zum Mindestentgelt in der Pflege; das Mindestlohngesetz (MiLoG) enthält aber ähnliche Regelungen. Es ist also wahrscheinlich, dass das BAG in einem solchen Fall eine ähnliche Entscheidung treffen wird. Fraglich ist aber, ob das Urteil auch für Altverträge gilt (dies vermute ich nicht), oder nur für neuere Verträge ab Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes bzw. der Pflegeverordnung. Ob das Bundesarbeitsgericht einen entsprechenden Hinweis gegeben hat in den Urteilsgründen ist derzeit noch unklar, da bislang nur die Pressemitteilung veröffentlicht wurde.
Quelle:
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 24.08.2016 – 5 AZR 703/15 –
Bundearbeitsgericht, Pressemitteilung Nr. 44/16
Ein Verzicht auf den entstandenen Anspruch auf das Mindestentgelt nach § 8 ist nur durch gerichtlichen Vergleich zulässig; im Übrigen ist ein Verzicht ausgeschlossen. Die Verwirkung des Anspruchs der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf das Mindestentgelt nach § 8 ist ausgeschlossen. Ausschlussfristen für die Geltendmachung des Anspruchs können ausschließlich in dem für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag nach den §§ 4 bis 6 oder dem der Rechtsverordnung nach § 7 zugrunde liegenden Tarifvertrag geregelt werden; die Frist muss mindestens sechs Monate betragen.
Eine Rechtsverordnung nach § 11 steht für die Anwendung der §§ 8 und 9 sowie der Abschnitte 5 und 6 einer Rechtsverordnung nach § 7 gleich.
Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte mit Urteil vom 29.06.2016 über die Frage zu entscheiden, ob der gesetzliche Mindestlohn von zurzeit 8,50 brutto auch für Bereitschaftszeiten zu zahlen sei.
Das Mindestlohngesetz (MiLoG), welches seit Anfang 2015 gilt, sieht gem. § 1 Abs. 2 eine Vergütung in Höhe des gesetzlichen Mindestlohn für alle zu erbrachten Arbeitsstunden zwar zwingend vor, jedoch lässt es offen, ob darunter nur jede in Vollarbeit abgeleistete Arbeitsstunde fällt, oder ob auch die in Bereitschaft verbrachte Zeit von dieser Vergütungsregelung miterfasst ist.
Geklagt hatte ein Rettungsassistent, dessen wöchentliche Arbeitszeit circa 48 Arbeitsstunden umfasste. Von diesen 48 Arbeitsstunden verbrachte er regelmäßig neun Stunden im Bereitschaftsdienst. Der Kläger war der Ansicht, dass die ihm hierfür gezahlte, monatliche Vergütung in Höhe von 2.680,31 € brutto zu gering ausgefallen sei. In diesem Sinne führte er an, dass die tarifliche Vergütungsregelung seit Inkrafttreten des MiLoG außer Kraft gesetzt sei und müssen Bereitschaftszeiten nun je Zeitstunde mit demselben Stundenlohn vergütet werden, wie jede in Vollarbeit abgeleistete Arbeitsstunde.
Das Arbeitsgericht Aachen in erster Instanz, sowie das dann zuständige Landesarbeitsgericht Köln wiesen die Klage ab. Zwar gaben sie dem Kläger dahingehend recht, dass auch durch den Arbeitnehmer wahrgenommene Bereitschaftszeiten mit dem gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten seien, jedoch übersteige der gezahlte Bruttomonatslohn auch unter Miteinbeziehung der durch den Kläger im Bereitschaftsdienst abgeleisteten Arbeitsstunden bereits deutlich den Betrag, der ihm bei Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns durch den Arbeitgeber zustünde.
So urteilte letztlich auch das BAG. Es bestätigte die Rechtsansicht des Klägers dahingehend, dass der Arbeitgeber gem. § 1 Abs. 2 des MiLoG jede gearbeitete Zeitstunde – unabhängig davon, ob diese nun in Vollarbeit oder im Bereitschaftsdienst abgeleistet wurde – mit dem gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten habe. Allerdings war im hier zu entscheidenden Fall auch das BAG der Ansicht, dass der Arbeitgeber seiner Pflicht, jede gearbeitete Zeitstunde mit dem gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten, durch das tatsächlich ausgezahlte Bruttomonatsgehalt bereits nachgekommen sei. Da das hier gezahlte Bruttomonatseinkommen bereits über dem nach dem MiLoG mindestens anzusetzenden Stundensatz lag, stand dem Rettungsassistenten hier jedoch keine Lohnnachzahlung zu.
Durch dieses Urteil hat das BAG also klargestellt, dass der gesetzliche Mindestlohn auch für Bereitschaftszeiten gilt und sorgte damit für mehr Rechtssicherheit. Einem Arbeitnehmer steht der gesetzliche Mindestlohn in Höhe von 8,50 € brutto für jede, auch im Bereitschaftsdienst gearbeitete, Zeitstunde umfassend zu.
Quelle: BAG v. 29.06.2016 – 5AZR 716/15 Pressemitteilung Nr. 33/16

Rechtsanwälte Lars Kohnen und Miguel Krag
Kohnen & Krag Rechtsanwälte